Weinberge im Rems-Murr-Kreis: Brachflächen und ihre Zukunft
Die Weinbauflächen im Rems-Murr-Kreis nehmen ab, während historische Flurbereinigungen für nachhaltige Bewirtschaftung sorgen.
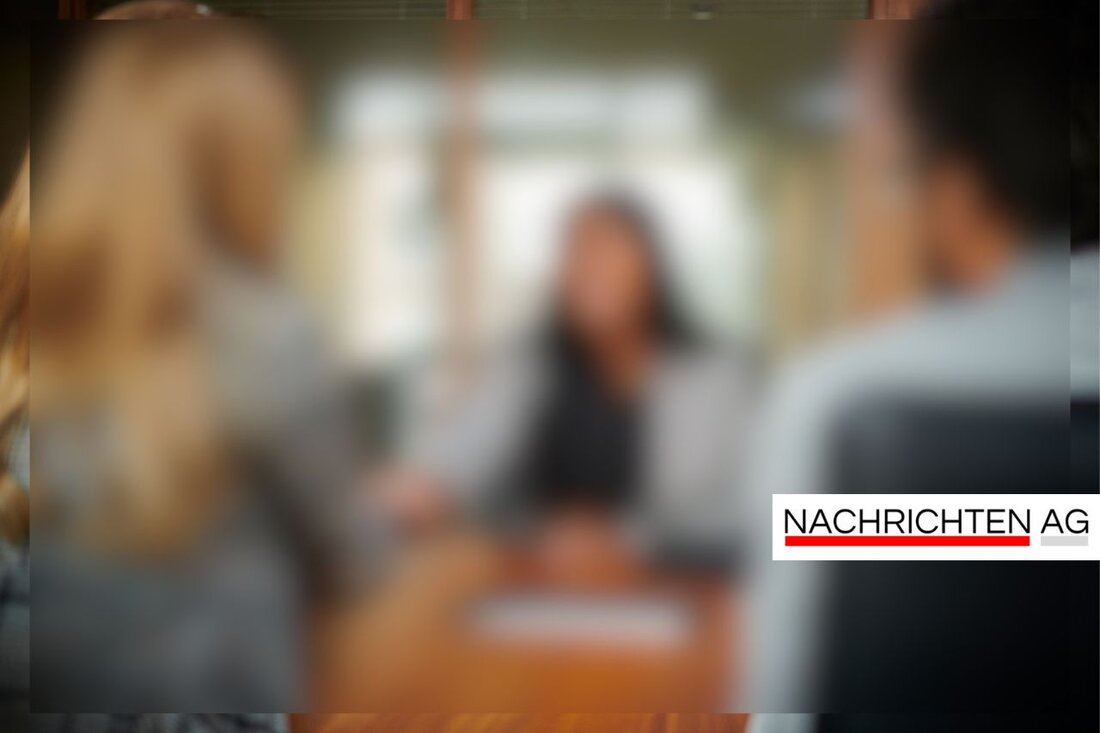
Weinberge im Rems-Murr-Kreis: Brachflächen und ihre Zukunft
Inmitten der malerischen Weinlandschaften des Rems-Murr-Kreises sieht man, wie immer mehr Weinberge brachliegen. Laut einer aktuellen Erhebung sind aktuell rund 49,5 Hektar der Rebfläche ungenutzt, während etwa 18,1 Hektar als „abgängig“ eingestuft sind – sie sind zwar nicht gerodet, werden aber nicht mehr bewirtschaftet. Im Juni 2025 meldete die Weinbaukartei 1.196,6 Hektar Rebfläche, ein Rückgang im Vergleich zu den 1.264,2 Hektar aus 2019. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, sowohl für die Winzer als auch für die Region insgesamt. Wo sollen die Besitzer brachliegender Weinberge Hilfe finden und was kann gegen diesen Trend unternommen werden?
Die Flurbereinigung, die im Remstal eine lange Geschichte hat, könnte ein Schlüssel zu einer Wiederbelebung der Weinbaukultur sein. Die erste große Rebflurbereinigung begann 1952 in Fellbach und die letzten Maßnahmen wurden am Bürger Schlossberg in Winnenden nach fast 50 Jahren abgeschlossen. Diese langen Prozesse wurden von einer Industrialisierung begleitet, die den Weinbau stark beeinflusste. Historisch betrachtet hatten die Weinerträge dieser Region oft das Zehnfache von dem, was heutzutage erzielt wird. Charakteristische Rebsorten mit Namen wie „Elender“ oder „Grobschwarz“ wurden für Massenproduktion kultiviert. Das bewusste Zusammenkeltern von weißen und roten Trauben als „Schiller“ stellte die damalige Zeit dar, in der der Fokus stark auf Quantität lag.
Wichtige Flurbereinigungsmaßnahmen
Die Mechanisierung im Weinbau, die seit den 1950er Jahren großen Einfluss nimmt, führte zur Notwendigkeit von Flurbereinigungen. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur die Bewirtschaftungsbedingungen, sondern sichern auch die nachhaltige Nutzung der Weinberge unter oft schwierigen topografischen Bedingungen. Fortschritte von der tierischen Zugkraft hin zu modernen Allradschleppern und vom Handanbau hin zu vollautomatischen Pflanztechniken mit Laserstrahlen revolutionieren das Feld. Die Flurbereinigung bietet hierbei nicht nur technische Lösungen, sondern leistet auch einen Beitrag zur Erhaltung der historischen Kulturlandschaft.
In den letzten Jahrzehnten gab es zudem beeindruckende Fortschritte in der Renaturierung von Gewässern und der Förderung der Artenvielfalt, die durch geeignete Schutzmaßnahmen unterstützt werden. So wird nicht nur die Region ökologisch gestärkt, sondern auch das touristische Potenzial der Weinlandschaften entlang der Deutschen Weinstraße gefördert.
Entwicklung und Beteiligung
Ein Flurbereinigungsbeschluss ist meist der erste Schritt, um einer Teilnehmergemeinschaft zu einem neuen Entwicklungsprozess zu verhelfen. Diese Gemeinschaft, die auch als Körperschaft des öffentlichen Rechts fungiert, versammelt Eigentümer, Behörden und Organisationen, um über die Zukunft der Weinberge zu diskutieren. Änderungen an betroffenen Grundstücken können dabei nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erfolgen, was das Thema der Mitbestimmung und Beteiligung in den Fokus rückt.
Die Herausforderungen, mit denen die Weinbauern konfrontiert sind, verdeutlichen die Bedeutung von Integration und gemeinsamer Planung für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Die Frage bleibt, wie die Region mit den brachliegenden Weinbergen umgehen möchte und welche Maßnahmen zur Revitalisierung ergriffen werden können.
Wie die Berichterstattung von ZVW zeigt, ist der Handlungsbedarf klar, und die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Weinbaus in der Region bleibt bestehen. Auch die Stuttgarter Nachrichten betonen die Wichtigkeit von Flurbereinigungen, um die Herausforderungen des Weinbaus langfristig zu meistern. Das Vitipendium hält uns zudem daran, wie historisch wertvoll und zukunftsträchtig der Weinbau in der Region sein kann, wenn ihn die richtigen Maßnahmen unterstützen.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto