Die bewegende Rückkehr: Familie Moos erzählt Ulms Geschichte im neuen Buch
Entdecken Sie die bewegende Geschichte der jüdischen Familie Moos in Ulm, präsentiert von Michael Moos am 3. Juli 2025.
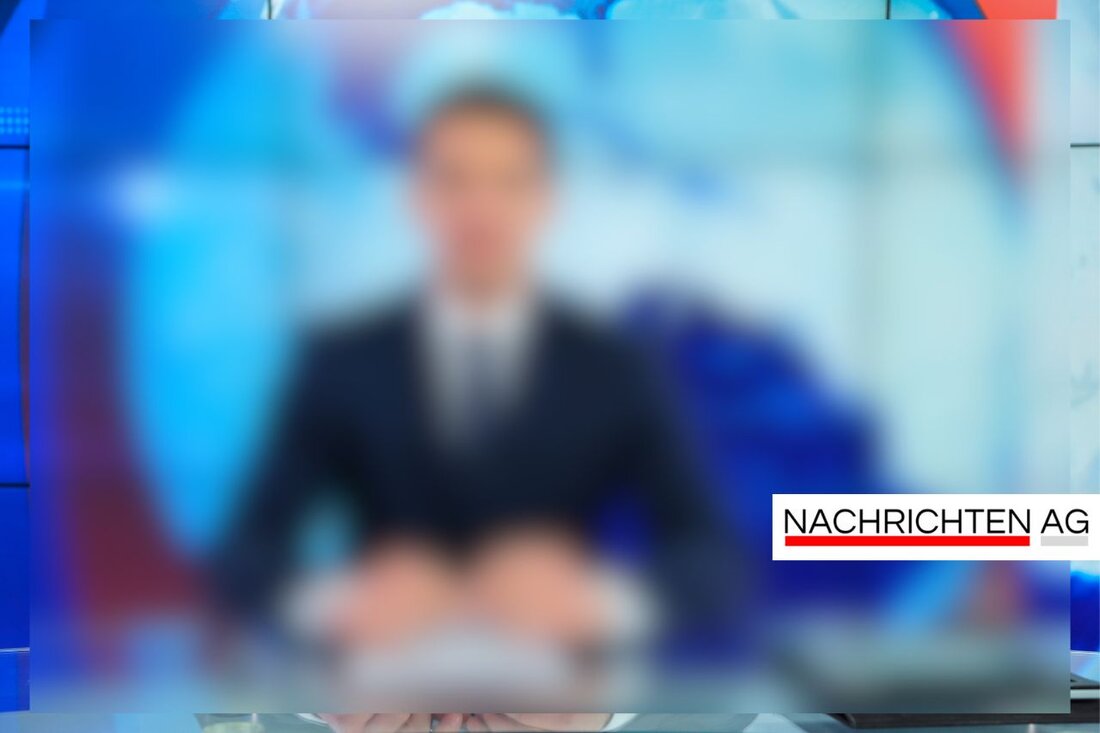
Die bewegende Rückkehr: Familie Moos erzählt Ulms Geschichte im neuen Buch
Ein Buch voller Erinnerungen und Aufarbeitung: Am 3. Juli wird Michael Moos sein Werk „Und nichts mehr wurde, wie es war…“ im Gewölbesaal des Hauses der Stadtgeschichte vorstellen. Nicola Wenge, die Leiterin des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg (DZOK), zeigt sich begeistert über die Veröffentlichung, die die Geschichte einer schwäbisch-jüdischen Familie erzählt. Es spannt sich ein Bogen über drei Generationen und gewährt authentische Einblicke in das Ulm der Nachkriegszeit, wie Augsburger Allgemeine berichtet.
Doch was steckt hinter dieser bewegenden Geschichte? Michael Moos, dessen Eltern 1933 aus Ulm nach Tel Aviv flohen, kehrte 1953 mit seinem sechsjährigen Sohn zurück in die Stadt. In seinem Buch thematisiert er die Flucht, Rückkehr und seine Kindheit in beiden Städten. Seine Erlebnisse reichen von einem Leben als linker Student bis hin zu seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Gemeinderat in Freiburg. Moos beschäftigt sich auch offen mit den generationsübergreifenden Traumata und der Suche nach Identität – Themen, die die Leser:innen in ihren Bann ziehen werden. Am Donnerstagabend erwartet die Gäste eine Lesung und ein anschließendes Gespräch mit dem Autor, die den Blick auf die Vergangenheit und die Herausforderungen der Gegenwart aufzeigen werden, so die Webseite des DZOK.
Ein Blick in die dunkle Vergangenheit
Die Rückkehr in eine Stadt mit einer so schmerzlichen Geschichte wirft viele Fragen auf. Die Verfolgung der jüdischen Bürger in Ulm begann unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und führte zu einer systematischen Diskriminierung, die auch Judas Geschäfte in der Stadt traf. Der erste Boykott jüdischer Geschäfte fand bereits am 11. März 1933 statt, gefolgt von einer Vielzahl von Maßnahmen, die darauf abzielten, die jüdische Bevölkerung zu isolieren, wie Stolpersteine für Ulm dokumentiert.
Die traurige Realität führte dazu, dass viele jüdische Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Zwischen 1933 und 1939 flüchteten 124 Juden aus Ulm, was fast ein Viertel der damaligen jüdischen Bevölkerung ausmachte. Die zurückgebliebenen Juden wurden oft in „Judenhäuser“ umgesiedelt, und Schreckenstaten wie die Reichspogromnacht im November 1938 trugen zur Zerstörung einer ganzen Gemeinschaft bei. Diese dunkle Vergangenheit bildet den Hintergrund zu Moos‘ Buch und der Rückkehr seiner Familie.
Ein Weg zur Heilung
Dass Moos seiner Familie und der Geschichte einen Raum gibt, kann als Akt der Heilung betrachtet werden. Durch das Schreiben und die Aufarbeitung persönlicher Erfahrungen trägt er dazu bei, dass die Erinnerungen an die Verfolgung der Juden in Ulm nicht in Vergessenheit geraten. In einer Zeit, in der das Bewusstsein für solche Themen weiter wächst, stellt seine Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur dar. Die Lesung am 3. Juli ist nicht nur ein literarisches, sondern auch ein historisches Ereignis für Ulm, das ###potenzielle Brücken baut### zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Für diejenigen, die sich für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Ulm interessieren, bietet das Buch von Michael Moos eine umfassende und bewegende Perspektive. Mit jedem Kapitel wird mehr Licht auf die Lebensrealitäten einer Familie geworfen, die vergange Generationen überdauern und deren Lebensgeschichten noch immer nachklingen.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto