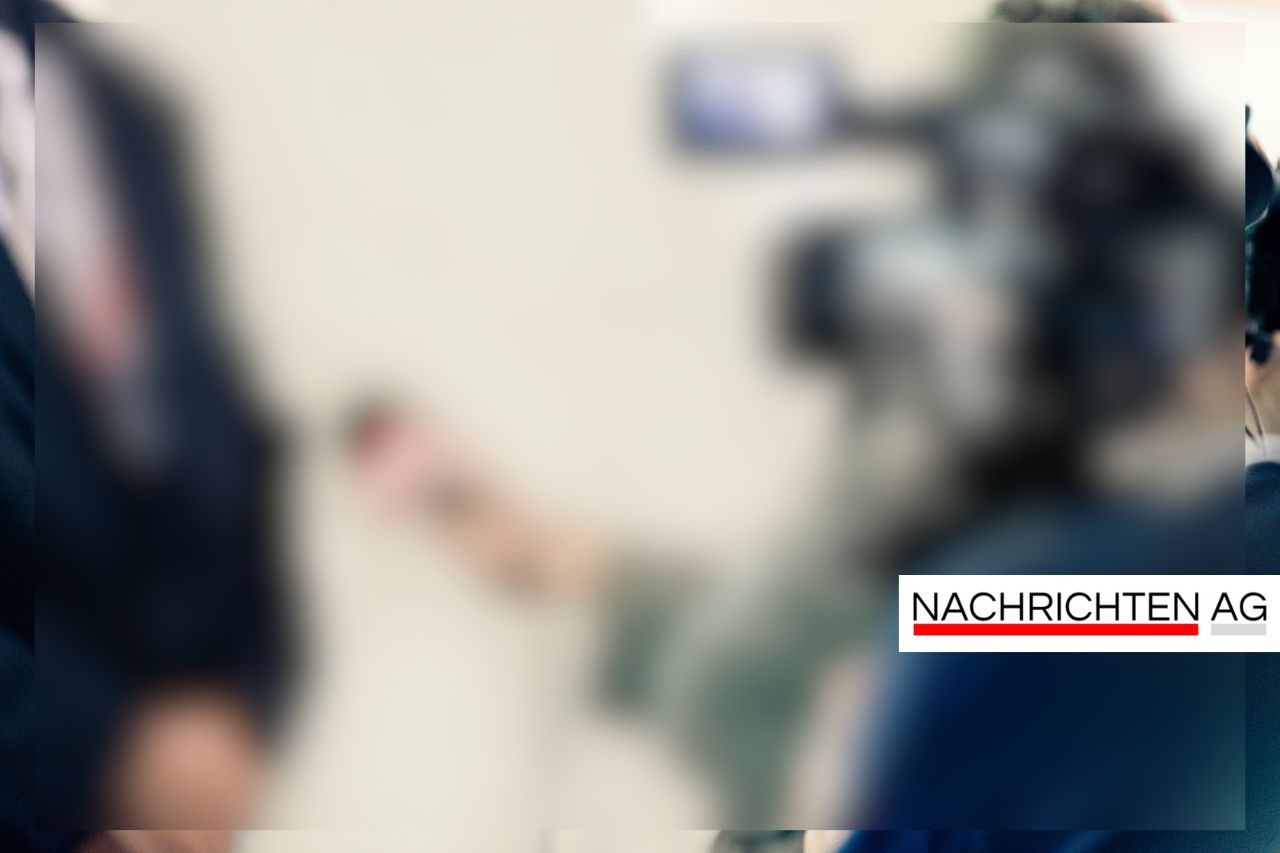
Unter dem Motto „Gott hört und antwortet“ versammelten sich kürzlich zahlreiche Frauen zu einer inspirierenden Wallfahrt, die vom Kölner Dom über die Maxstraße zur beeindruckenden Basilika St. Ulrich und Afra führte. Diese besondere Veranstaltung fand großen Anklang und wurde von Ruth Hoffmann, der geistlichen Beirätin beim Frauenbund Diözesanverband Augsburg, eröffnet. Hoffmann rückte in ihrer Ansprache die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Gott ins Licht, ein Thema, das viele der Teilnehmenden berührte. Sie erinnerte an Geschichten aus der Bibel, insbesondere an die von Hagar und der Syrophönizierin, die für ihre Predigt als Grundlage diente. Dabei kam der Dialog mit Abt Johannes Eckert zustande, der gemeinsam mit Hoffmann die Gedankenwelt von Jesus und der heidnischen Frau erkundete. Der Austausch führte zu neuen Erkenntnissen, mit denen die Teilnehmerinnen bereichert aus der Veranstaltung gingen.
Nach der Messe segnete Abt Johannes Eckert die traditionellen Ulrichsbrote, die in sechs Körben vor dem Altar bereitstanden. Diese „Doppelsemmeln“, die seit 1947 fester Bestandteil der Wallfahrt sind, laden zum Teilen ein und stehen symbolisch für Frieden und Versöhnung. Gegen eine Spende wurden die Brote an die Anwesenden verteilt, was das Gemeinschaftsgefühl noch zusätzlich stärkte. Die Wallfahrt endete mit einem geselligen Frühstück im Haus Sankt Ulrich, bei dem man die Erlebnisse des Tages Revue passieren ließ und die Verbundenheit unter den Frauen zelebrierte.
Die Tradition der Wallfahrten
Wallfahrten haben im Christentum eine lange und reiche Tradition. Über 40 Millionen Menschen weltweit nehmen jährlich an diesen Pilgerreisen teil. Die ersten Nachweise für Wallfahrten reichen bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. zurück, obwohl die Teilnahme nicht als religiöse Pflicht angesehen wird, wie es im Islam der Fall ist. Dies nahm die verschiedenen Konfessionen unterschiedlich auf: Der Protestantismus, vertreten durch Figuren wie Luther und Zwingli, lehnte Wallfahrten von Anfang an ab und sah sie als Ausdruck „offenkundiger Gottlosigkeit“ an.
Bayern beherbergt mit Altötting und dem Heiligen Berg Andechs einige der bekanntesten Wallfahrtsorte. Letzterer gilt als ältester Wallfahrtsort des Bundeslandes und zieht seit Jahrhunderten Pilger an, die um Heilung, Führung bei Entscheidungen oder Segen und Schutz bitten. Die Benediktinermönche sind seit 1455 für die Pflege der Wallfahrten hier verantwortlich und gestalten diese zu einem spirituellen Erlebnis, das fest in der Gemeinschaft verankert ist. Ein besonders populäres Ereignis ist das Dreihostienfest, das jährlich im September gefeiert wird und einen Höhepunkt im Wallfahrtskalender darstellt.
Die Bedeutung von Wallfahrten lässt sich nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Teilen der Welt erkennen. Orte wie Lourdes, Fatima und Santiago de Compostela sind durch Marienerscheinungen oder heilige Relikte zu beliebten Pilgerzielen geworden. Solche Reisen bieten nicht nur die Möglichkeit, den Glauben zu stärken, sondern auch Gemeinschaft und Solidarität zu erleben. Wenn also das nächste Mal die Frage aufkommt, was das Christentum und seine Traditionen prägt, ist die Antwort klar: Es sind die Pilgerreisen, die das Herz des Glaubens berühren und ins Leben der Gläubigen einfließen.
So bleibt die Wallfahrt nicht nur ein religiöses Ritual, sondern auch ein Ort des Austauschs und der Hoffnung. Es zeigt sich, dass Gott durch solche Zusammenkünfte gehört wird, und ein Stück mehr Vertrauen in die Führung des Lebens entsteht. Wer Teil dieser Erfahrungen werden möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten, jedoch erfolgt alles ohne Zwang und aus freiem Herzen.
