Kraftwerks-Planung: 17 Milliarden Euro für sichere Stromversorgung!
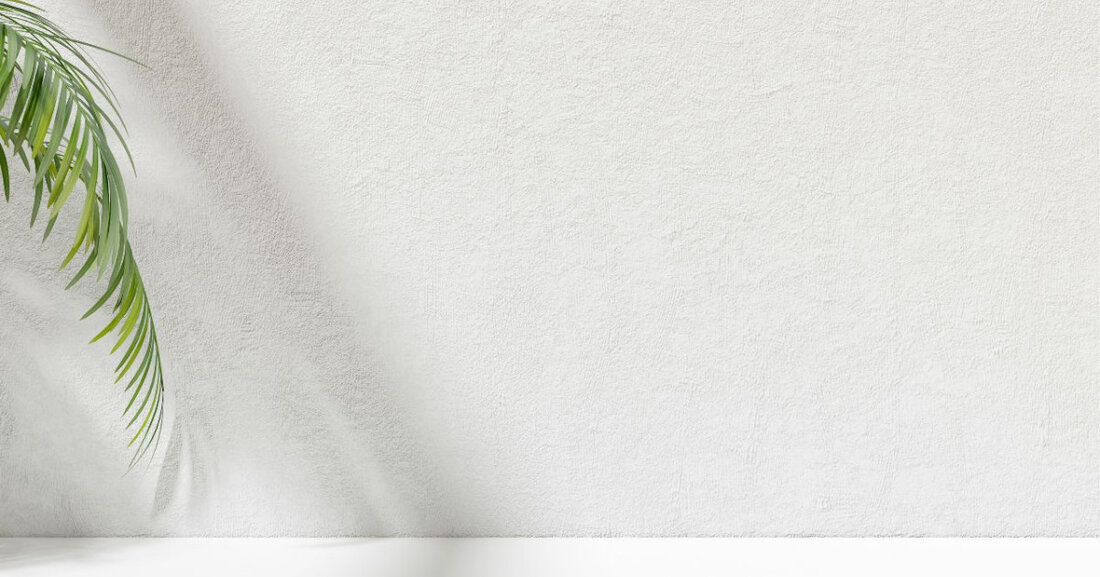
nicht angegeben, Deutschland - Die neue Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) hat ehrgeizige Pläne für die zukünftige Stromversorgung in Deutschland. Geplant ist der Bau zahlreicher Gaskraftwerke bis 2030, um den wachsenden Bedarf zu decken und gleichzeitig einen Ausgleich zu den bevorstehenden Stilllegungen von Kraftwerken zu schaffen. Nach Aussagen des BDEW werden in den nächsten zehn Jahren Kraftwerke mit einer steuerbaren Leistung von rund 30 GW stillgelegt, was der Leistung von etwa zwei Dutzend Atomkraftwerken entspricht. Diese Schließungen betreffen sowohl gesetzlich geregelte Kohlekraftwerke als auch überalterte Anlagen.
Parallel zu den Stilllegungen sollen Wind- und Solaranlagen ausgebaut werden. Dennoch äußern Experten Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit, insbesondere bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Um dem entgegenzuwirken, wird ein Kraftwerkssicherungsgesetz (KWSG) entwickelt, das neue Gaskraftwerke mit insgesamt 20 GW fördern soll. Der Staat plant Subventionen in Höhe von 17 Milliarden Euro über den Zeitraum von 2029 bis 2045 für den Bau und Betrieb dieser neuen Gaskraftwerke.
Finanzierung und Herausforderungen
Die Notwendigkeit von Zuschüssen ergibt sich aus der Tatsache, dass die neuen Turbinen nur wenige Stunden im Jahr betrieben werden. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt über eine neue Umlage auf der Stromrechnung, die voraussichtlich 0,5 Cent pro Kilowattstunde betragen wird. Die ambitionierte Planung sieht vor, dass die Konstruktion der Kraftwerke vier bis sechs Jahre in Anspruch nimmt. Die Bundesnetzagentur wird etwa sechs Monate benötigen, um die Ausschreibungen neuer Stromerzeuger durchzuführen.
Es gibt jedoch auch erhebliche Bedenken, dass die Ausschreibungen für neue Kraftwerke aufgrund finanzieller Risiken für die Betreiber scheitern könnten. Katherina Reiche wird von BDEW-Chefin Kerstin Andreae unterstützt, die eine zügige Umsetzung des KWSG fordert und empfiehlt, die unvollendete Vorlage des früheren Ministers Robert Habeck in ein geltendes Gesetz zu überführen. Es bleibt jedoch unklar, wie viele Anbieter sich tatsächlich um die neuen Kapazitäten bewerben werden.
Technologische Anpassungen und Strategien
Habecks ursprünglicher Plan sah eine Kapazität von 10 GW vor, bestehend aus 5 GW konventionellen Gasturbinen und weiteren 5 GW für den Umstieg auf grünen Wasserstoff. Diese Unsicherheiten bezüglich der Verfügbarkeit und der Mengen von grünem Wasserstoff stellen für Energiemanager ein Risiko dar. Der BDEW schlägt vor, Rückzahlungen von Subventionen zu ermäßigen und Bonuszahlungen für Betreiber einzuführen, um Anreize zu schaffen. Sollten weniger Bewerbungen als benötigte Kapazitäten eintrudeln, könnten Standard-Gaskraftwerke einspringen.
Die ersten Inbetriebnahmen der neuen Kraftwerke könnten Ende 2030 oder Anfang 2031 erfolgen. Das KWSG ist nicht eine alleinstehende Lösung, sondern sollte im Rahmen eines größeren Kontextes betrachtet werden. Diskutiert wird auch der Aufbau eines Kapazitätsmarktes, um die Bedingungen für den Einsatz der Kraftwerke zu klären. Kritiker haben angemerkt, dass die Rolle von Batteriespeichern im KWSG mit lediglich 0,5 GW zu gering gewichtet wird und fordern mehr Flexibilität und Digitalisierung in der Energienutzung.
Zusätzlich gibt es Sicherheitsmaßnahmen, die verhindern sollen, dass Blackouts entstehen. Die Bundesnetzagentur hat die Befugnis, das Abschalten von Kohlekraftwerken zu verbieten, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Die Entwicklungen im Energiebereich stehen somit unter dem Druck, Handlungsschritte schnell umzusetzen, um Deutschlands Zukunft in der Energieversorgung nachhaltig zu gestalten.
| Details | |
|---|---|
| Ort | nicht angegeben, Deutschland |
| Quellen | |
