Eltern weniger zufrieden, aber finden mehr Lebenssinn – was steckt dahinter?
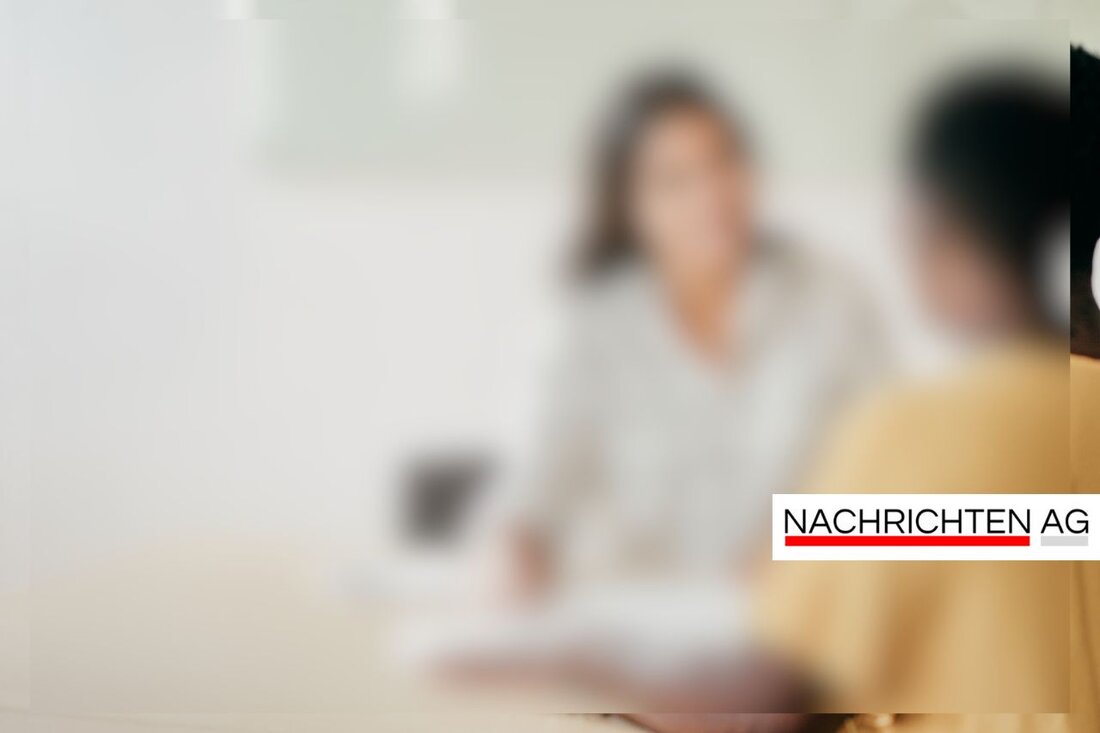
Köln, Deutschland - Eine aktuelle Studie zeigt, dass Eltern durchschnittlich weniger Zufriedenheit empfinden als kinderlose Personen, jedoch gleichzeitig ein höheres Gefühl der Sinnhaftigkeit im Leben erfahren. Diese Untersuchungen wurden in 30 Ländern durchgeführt und im renommierten „Journal of Marriage and Family“ veröffentlicht. Laut dem Mitautor Ansgar Hudde von der Universität Köln beweist die Forschung, dass die Elternschaft nicht automatisch zu einer höheren Zufriedenheit führt.
Die Studienergebnisse sind besonders aufschlussreich: Tendenziell sind Frauen, insbesondere alleinerziehende, junge Frauen oder solche ohne höhere Bildungsabschlüsse, unzufriedener. Zudem berichten Eltern in skandinavischen Ländern von einem signifikant höheren Lebenssinn und Zufriedenheit. Dies wird teils auf die kinderfreundlichen Politiken dieser Länder zurückgeführt, die gute Kinderbetreuung sowie finanzielle Unterstützung wie Elterngeld bieten.
Leben mit Kindern: Erwartung und Realität
Die Untersuchung beruht auf Daten von über 43.000 Teilnehmern des European Social Survey. Hudde betont die Relevanz dieser Ergebnisse für die deutsche Politik, insbesondere da er kritisiert, dass die deutsche Familienpolitik seit den 2000er Jahren an Schwung verloren hat. In diesem Kontext zeigt sich eine veränderte Mentalität in der Gesellschaft: Immer mehr Menschen suchen nicht nur nach Freude, sondern auch nach Sinn, wobei viele in der Elternschaft diesen Sinn finden.
Zusätzlich forscht das Team um Prof. Dr. Matthias Pollmann-Schult von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zu den individuellen und kontextuellen Faktoren, die die Lebenszufriedenheit von Eltern beeinflussen. Das Projekt hat zwischen 2016 und 2019 stattgefunden und untersucht die Wechselwirkungen zwischen persönlichen, familiären und institutionellen Bedingungen.
Kulturelle Erwartungen an die Elternschaft
Eine Analyse von Klaus Preisner von der Universität Zürich und weiteren Forschern bietet weitere Einblicke. Die Studie untersucht, wie gesellschaftliche Erwartungen die Lebenszufriedenheit von Eltern beeinflussen. Über einen Zeitraum von 31 Jahren wurde in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) die Zustimmung zu traditionellen Rollenverteilungen erfasst. So sank die Unterstützung für die Aussage, dass Männer erwerbstätig sein und Frauen den Haushalt führen sollten, von 50% in den 1980er Jahren auf 20% im Jahr 2015.
Diese Veränderungen zeigen sich auch in der Lebenszufriedenheit von Eltern. In den 1980er Jahren waren Mütter weniger zufrieden im Vergleich zu kinderlosen Frauen, während sich dieser sogenannte „maternal happiness gap“ mittlerweile geschlossen hat. Heutzutage berichten Mütter von einer ähnlichen Lebenszufriedenheit wie kinderlose Frauen. Trotz der anhaltenden Diskussionen über die Belastungen der Elternschaft ist diese Gleichheit ein positives Signal für die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte.
Insgesamt verdeutlichen die unterschiedlichen Studien, dass Elternschaft nicht einfach mit Lebenszufriedenheit gleichgesetzt werden kann, sondern dass Kontextfaktoren sowie gesellschaftliche Erwartungen und Unterstützungsstrukturen eine entscheidende Rolle spielen.
Die Ergebnisse bieten nicht nur einen tiefen Einblick in die Herausforderungen von Eltern, sondern auch in die Notwendigkeiten politischer Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien.
Für weitere Details zu den Studien können die vollständigen Berichte auf folgenden Webseiten nachgelesen werden: ZVW, OVGU, DIW.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Köln, Deutschland |
| Quellen | |
