Zukunftsfragen mit Ulrike Kuch: Bauhaus Weimar sucht neue Wege!
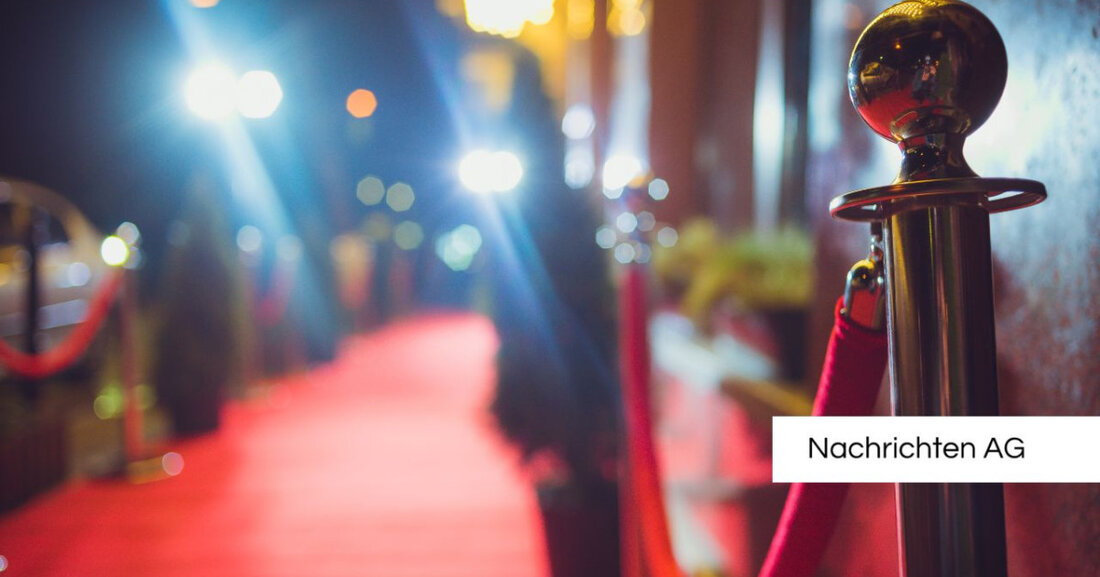
Weimar, Deutschland - Ulrike Kuch, Hochschuldozentin für Architekturtheorie und Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Universität Weimar, hat zusammen mit Maximilian Rünker die Veranstaltungsreihe „Beyond Now“ initiiert. Diese Reihe beschäftigt sich mit wesentlichen Zukunftsfragen der Gesellschaft und umfasst sieben Veranstaltungen, die unterschiedliche lokale, nationale sowie internationale Perspektiven diskutieren. Die Auftaktveranstaltung fand am 10. April 2023 statt und thematisierte „Was ist gesellschaftliche Transformation?“
Die zweite Veranstaltung, die am 24. April 2023 stattfand, widmete sich der „Zukunft der Demokratie“. Die Bauhaus-Universität Weimar bringt eigene Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus, der DDR und der Wiedervereinigung in die Diskussion ein, die maßgeblich das Demokratieverständnis prägen. Am 8. Mai 2023 wird das 80. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert, was die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus markiert. Eine weitere interessante Veranstaltung zur „Zukunft der Geschichte“ fand am 15. Mai 2023 mit den Referenten Jens-Christian Wagner und Jan von Brevern statt.
Kontroversen um Gedenkevents
In der aktuellen politischen Landschaft gibt es jedoch auch Konflikte, die mit der Auseinandersetzung um historische Erinnerungen verbunden sind. Beispielsweise führt der Streit über den Redner bei der Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald zu rechtlichen und politischen Spannungen. Der Gedenkstätten-Leiter Jens-Christian Wagner kritisierte die Einflussnahme der israelischen Regierung, die zur Rücknahme der geplanten Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm führte. Wagner beschrieb diese Einflussnahme als Geschichtspolitik auf dem Rücken der Opfer.
Die Gedenkfeier, die am 6. April 2025 in Weimar stattfinden soll, markiert den 80. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora, bei der etwa zehn Überlebende des NS-Terrors erwartet werden. Wagner äußerte Bedenken bezüglich eines zu hohen Drucks, um Konflikte zu vermeiden und die Überlebenden nicht zu belasten, nachdem Boehm, der als Kritiker der israelischen Regierung gilt, aus der Veranstaltung ausgeschlossen wurde.
Die israelische Botschaft reagierte scharf auf diesen Rückzug und bezeichnete die Einladung an Boehm als empörend und beleidigend für die Opfer. Boehm, der selbst Holocaustüberlebende in seiner Familie hat, wird für seine kritische Haltung zur israelischen Gedenkkultur durchaus respektiert. In dieser Situation hat die Gedenkstätte die Todesopfer in Buchenwald auf 56.000 und in Mittelbau-Dora auf 20.000 geschätzt. An dem zentralen Gedenkakt werden auch prominente Persönlichkeiten wie der Ministerpräsident von Thüringen, Mario Voigt, und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff teilnehmen.
Architektur als Spiegel der Gesellschaft
Architektur spielt in der heutigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle, da sie nicht nur als Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse angesehen wird, sondern auch aktiv zu deren Gestaltung beiträgt. Diskussionen über Stadtpolitik, Städtebau und Stadtplanung verdeutlichen, dass Architektur gezielt für Stadt- oder Quartierserneuerungen strategisch eingesetzt wird. Beispiele wie das Guggenheim-Museum in Bilbao oder die Hamburger Hafen-City verdeutlichen, wie markante Bauprojekte als Ausdruck gesellschaftlicher Leitbilder und Strukturen fungieren.
Architektursoziologen betonen, dass Architektur als Konstruktionsmacht von Lebenswelten fungiert und somit soziale Beziehungen sowohl reproduziert als auch beeinflusst. Eine besonders wichtige Perspektive ist die geschlechterbezogene Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt, die im Wohnbereich eine zentrale Rolle spielt. Die Wohnstrukturen der fordistischen Epoche gelten als Indikatoren patriarchaler Verhältnisse, was durch die feministische Stadt- und Planungskritik der 1970er Jahre verstärkt wurde.
Die Herausforderungen, die durch Gentrifizierung entstehen, verdeutlichen, dass neue Geschlechterrollen und Identitäten in den Urbanisierungsprozess integriert werden. Kritische Genderforschung hebt hervor, dass der strukturierte Rückzug einkommensschwacher Schichten durch Gentrifizierung eine nachhaltige Diskussion über den sozialen Wandel und den Einfluss von Architektur anregt. Diese vielfältigen Themen belegen, wie eng Architektur und Gesellschaft miteinander verwoben sind.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Weimar, Deutschland |
| Quellen | |
