Bundesarbeitsgericht-Urteil: Gleiche Arbeit, ungleicher Lohn – was nun?
Das BAG-Urteil vom 27. Juni 2025 entscheidet über Lohnunterschiede zwischen MFA und OTAs, beleuchtet Gleichbehandlungsgrundsatz und zukünftige Entgelttransparenz.
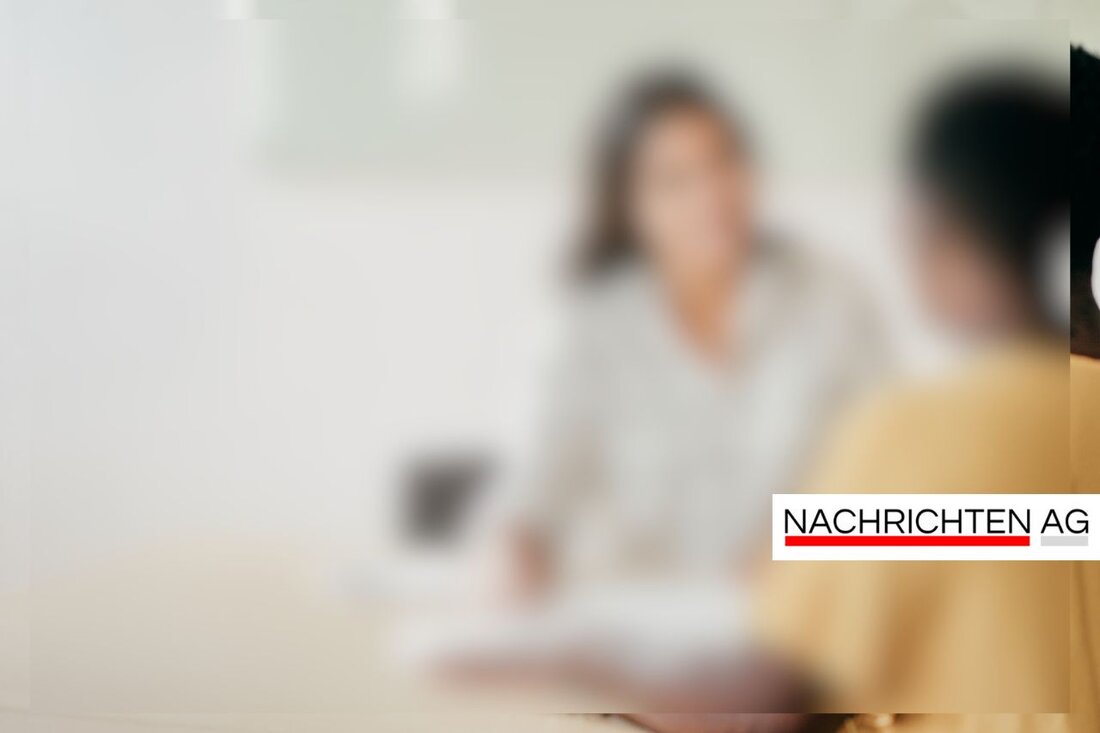
Bundesarbeitsgericht-Urteil: Gleiche Arbeit, ungleicher Lohn – was nun?
Gerade erst hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 27. Juni 2025 in Erfurt ein Urteil veröffentlicht, das bei vielen für Aufregung sorgt. Über das Recht auf gleiche Vergütung trotz vergleichbarer Tätigkeiten wurde entschieden, und die Auswirkungen sind beachtlich. Eine medizinische Fachangestellte (MFA) hatte geklagt, da sie deutlich weniger verdiente als ihre Kollegin, die als operationstechnische Assistentin (OTA) arbeitete. Trotz übereinstimmender Arbeit im OP-Team wurde ihre Klage abgewiesen – ein klarer Hinweis darauf, dass unterschiedliche Gehälter in bestimmten Fällen zulässig sind, wenn es sachliche Gründe, wie etwa eine längere, spezifischere Ausbildung, gibt.
Die Begründung des BAG bewegt sich im Kontext des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Tarifautonomie. So dürfen Arbeitgeber unterschiedliche Gehälter festlegen, solange diese Unterschiede einer nachvollziehbaren Logik folgen. Insbesondere, wenn Faktoren wie Ausbildung, Verantwortung oder die Art des Arbeitszeitmodells eine Rolle spielen. Es bleibt jedoch entscheidend, dass Ungleichbehandlungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder individuellen Verhandlungsgeschick nicht toleriert werden berichtet.
Die Herausforderung der Lohnunterschiede
Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bleibt ein zentrales Thema in Deutschland. Unter den vielen Ursachen sind Teilzeitarbeit und die Wahl von Berufen in sozialen Dienstleistungsbereichen, die häufig schlechter bezahlt werden. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beträgt die unbereinigte Gender Pay Gap erstaunliche 16 Prozent, während bei vergleichbaren Qualifikationen nur noch 6 Prozent davon übrigbleiben. Das ist alarmierend und zeigt, dass es nicht nur an individuellen Entscheidungen liegt, sondern auch an strukturellen Problemen.
Das jüngste Urteil könnte das Bewusstsein für diese Diskrepanzen schärfen. Arbeitgeber sehen sich zunehmend dem Risiko ausgesetzt, für schlechtere Entlohnung von Frauen in größeren Gruppen zur Verantwortung gezogen zu werden. Hier greift der europäische Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit. Die Clou ist, dass die Europarechtslage in den Fokus rückt und damit der Spielraum für nationale Unterschiede weiter eingeschränkt wird.
Was bringt die Zukunft?
Ab Mitte 2026 wird eine neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz erlassen. Diese sieht vor, dass Unternehmen künftig verpflichtet sind, ihre Lohnstrukturen offen zu legen. Unternehmen werden in der Verantwortung stehen, die Vergütungsstrukturen transparent zu gestalten, und nicht selten wird dieser Wandel auch Gesellschaften ins Wanken bringen. Hektische Debatten über Gerechtigkeit und Fairness werden dadurch nicht auszuschließen sein. Dies erkennt auch das BAG an, das mit dieser Entscheidung den Weg für umfassende Diskussionen über die Entlohnung in verschiedenen Berufen ebnet unterstreicht.
Insgesamt ist das Urteil ein klarer Appell an die Unternehmen, ihre Entlohnungssysteme zu überdenken und zu modernisieren. Um den Gender Pay Gap wirksam zu schließen, sind nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen nötig, sondern auch ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Die Hoffnung liegt darauf, dass diese Diskussion nicht nur Führungskräfte, sondern auch die gesamte Belegschaft erreicht – denn faire Entlohnung muss ein Grundrecht für alle Beschäftigten sein.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto