Neues Wahlrecht in Hessen: D’Hondt-Verfahren sorgt für Aufregung!
Hessen reformiert das Kommunalwahlrecht: Neues d’Hondt-Verfahren soll größere Parteien begünstigen. Wahlen am 15. März 2026.
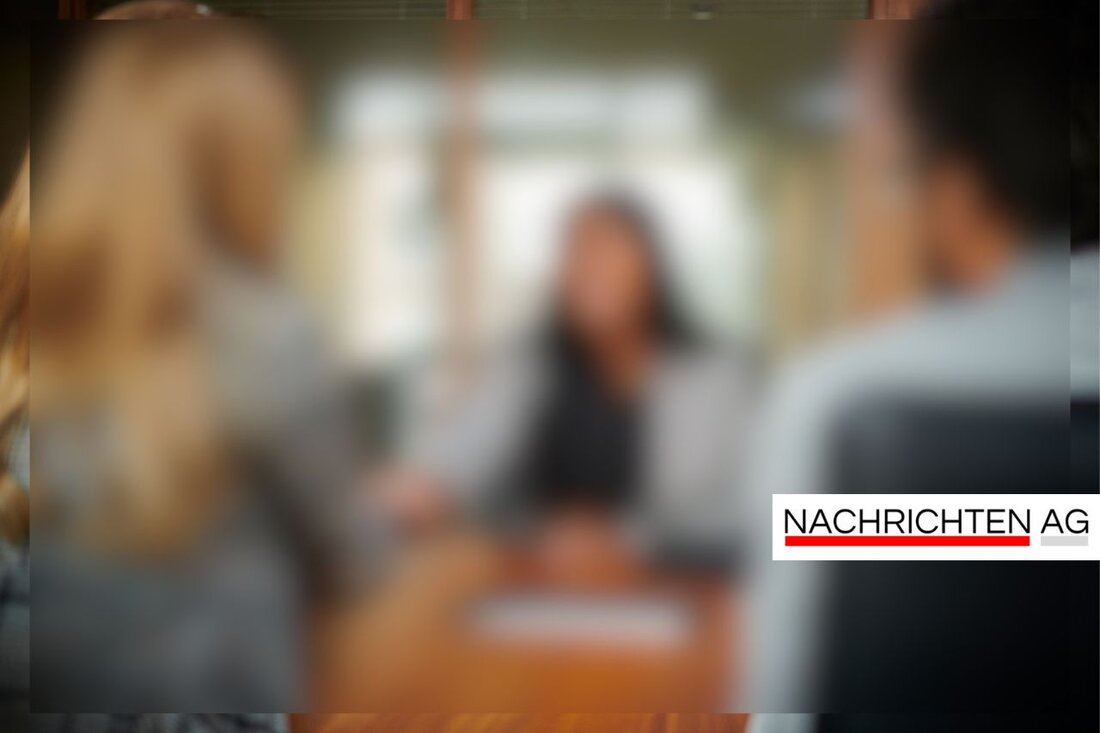
Neues Wahlrecht in Hessen: D’Hondt-Verfahren sorgt für Aufregung!
Die Vorbereitung auf die hessischen Kommunalwahlen am 15. März 2026 ist in vollem Gange, und es gibt einiges zu besprechen. Das neue Sitzzuteilungsverfahren, das d’Hondt-Verfahren, wird statt des bislang verwendeten Hare/Niemeyer-Systems die Grundlage für die Vergabe von Mandaten in den Gemeinden und Kreistagen sein. Diese Entscheidung, die am 27. März 2025 im Landtag in Wiesbaden getroffen wurde, hat bereits für hitzige Debatten gesorgt. Während die schwarz-rote Koalition aus CDU und SPD für die Reform stimmte, lehnten die Oppositionsfraktionen, darunter die Grünen, die AfD und die FDP, die Gesetzesnovelle mit Nachdruck ab.
Die Umstellung auf das d’Hondt-Verfahren, das seit 1945 häufig im deutschen Wahlrecht genutzt wurde, wirft eine Reihe von Fragen auf. Dieses Divisorverfahren teilt die Stimmen der Parteien durch eine fortlaufende Zählung (1, 2, 3, …) und vergibt die Sitze gemäß der höchsten erreichten Zahlen. Kritiker sind sich einig, dass diese Wahlmethodik tendenziell größere Parteien begünstigt. So erinnert sich der Marburger Verfassungsrechtler Hans-Detlef Horn daran, dass das Verfahren mitunter zu Verzerrungen führen und die Wahlgleichheit gefährden kann. Daher fordert er eine umfassende Überprüfung der bestehenden Wahlrechtsbestimmungen.
Wahlrecht im Wandel
Die Umstellung vom Hare/Niemeyer-Verfahren, das seit 1981 in Hessen angewendet wurde und auf einer anderen Berechnungsmethode basiert, hin zum d’Hondt-System, hat in der politisch interessierten Öffentlichkeit für große Diskussionen gesorgt. Unter dem Hare-Niemeyer-Verfahren wurden die Stimmen multipliziert und dann durch die Anzahl der Sitze geteilt, was in der Vergangenheit eine proportionalere Vertretung ermöglichte. Das d’Hondt-System könnte nun dazu führen, dass im Frankfurter Römer statt 16 nur noch 11 Gruppierungen vertreten sind, wie Innenminister Roman Poseck (CDU) berichtet. Dies könnte die Zersplitterung der Parlamente verringern, betont Poseck. Doch zahlreiche Stimmen warnen, dass dies den Einfluss kleinerer Parteien stärkere schmälern könnte, was als Gefahr für die Demokratie wahrgenommen wird.
Das Bundesverfassungsgericht weist ebenfalls darauf hin, dass Wahlrechtsbestimmungen nicht ewig unbedenklich sind. Die Reaktionen auf die Reform sind daher gespalten: Auf der einen Seite steht die Regierung, die die Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretung verbessern möchte; auf der anderen Seite die Kritiker, die eine Benachteiligung kleinerer Parteien befürchten und rechtliche Schritte erwägen. Die FDP hat bereits Klage gegen die Reform eingereicht. Ihre Befürchtungen sind nicht unbegründet. In der Vergangenheit gab es bereits Beispiele, in denen Parteien aufgrund der Anwendung des d’Hondt-Verfahrens schlechtere Ergebnisse erzielten, als es ihrem Stimmenanteil entsprach.
Der Ausblick auf die Kommunalwahlen
Am 15. März 2026 wird sich also zeigen, ob die Risiken, die mit dem d’Hondt-Verfahren einhergehen, tatsächlich eintreten werden. Wissenschafter und Wahlrechtsexperten beobachten die Entwicklung mit Spannung, denn die Entscheidung des hessischen Staatsgerichtshofs, die für die endgültige Implementierung der Reform kritisch sein wird, wird als mathematische Herausforderung betrachtet. Schließlich gilt es, das Gleichgewicht zwischen größeren und kleineren Parteien zu wahren, während gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Parlamente gefördert werden soll.
Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die politischen Strukturen nach der Reform entwickeln und ob die Wähler:innen an den Urnen tatsächlich eine klare, verlässliche Vertretung ihrer Interessen finden werden. Die kommenden Monate versprechen also viel Spannung und könnten entscheidend für die politische Landschaft in Hessen sein.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto