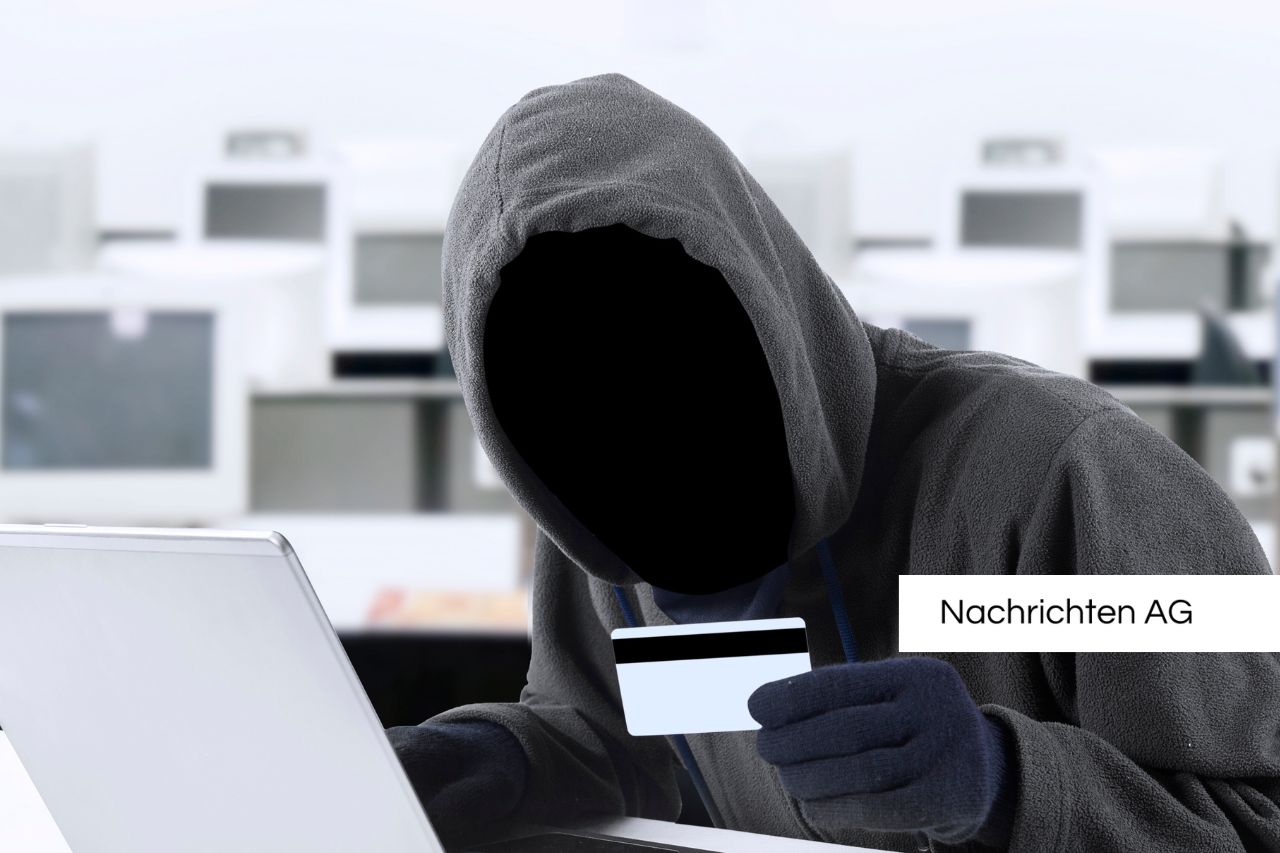
Am 24. August 2025 wird in Gettorf das 75-jährige Bestehen der Siedlung im Parkwinkel gefeiert. Diese Altersmarke ist nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch ein Rückblick auf die bewegte Geschichte des Wohnens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit litt Deutschland unter massiver Wohnungsnot. Hans-Jürgen Doose, 81 Jahre alt, erinnert sich lebhaft an seine Kindheit in den 50er-Jahren in Gettorf, wo die ersten Siedlungshäuser zwischen Fliederweg und Erlengrund errichtet wurden. „Wir waren die erste Generation, die hier lebte“, erzählt Doose und wirft einen Blick in die Vergangenheit, wo gemeindeeigene Grundstücke für gerade mal 40 Pfennig pro Quadratmeter verkauft wurden. Diese Projekte waren notwendig, da in den Westzonen der Bundesrepublik mehr als 5,5 Millionen Wohnungen fehlten, wie die bpb berichtet.
Die Not war so groß, dass die Gemeinde Ende der 40er-Jahre 20 Hektar Land kaufte, um neue Wohnmöglichkeiten zu schaffen. Ab 1950 begannen die ersten Familien, im Rosenweg ihre Häuser zu errichten. Die Neubauten waren klein konzipiert: Mit einer Wohnfläche von 40 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 60 Quadratmetern hatten diese Bauten eine Wohnküche sowie Kammern, die als Schlaf- und Kinderzimmer dienten. Der damalige Baupreis von 10.850 Mark war für viele Familien eine große Herausforderung, schließlich betrug der durchschnittliche Monatsverdienst nur 135 Mark. In Eigenleistung wurden rund 3.200 D-Mark in die Bauprojekte investiert, und viele Männer leisteten harte handwerkliche Arbeit, um die dringend benötigten Mauersteine herzustellen.
Ein Rückblick auf die Anfänge
Die Siedlung hatte ihre Eigenheiten. So waren etwa Trockentoiletten üblich, bis Hans-Jürgen Dooses Mutter darauf bestand, eine Spültoilette zu installieren. Einkommensschwache Haushalte waren auf Selbstversorgung angewiesen, und viele Siedler hielten Schweine und Hühner auf den großzügig bemessenen Grundstücken von etwa 800 Quadratmetern. Ralf Lemke, 67 Jahre alt und in der Siedlung geboren, widmete sich zusammen mit Gesa Gaedeke und Hauke Christiansen der Erfassung dieser Geschichte und arbeitete an einer Chronik, die die letzten 75 Jahre dokumentiert.
Die Anforderungen an die Häuser änderten sich über die Jahre, was zur Expansion der Siedlung führte. Der letzte Bauabschnitt fand zwischen 1982 und 1985 statt, und die Siedlung entwickelte sich ständig weiter. Hans-Jürgen Doose, der einzige noch lebende Bewohner der ersten Generation, verlässt sich weiterhin auf das gewachsene Gemeinschaftsgefühl, das viele der ursprünglich geflochtenen Nachbarschaften prägte.
Der Kontext der Wohnungspolitik in Deutschland
Der Blick auf die Gettorfer Siedlung wirft ein Licht auf die breitere Wohnungspolitik in Deutschland. Diese entwickelte sich im Nachkriegskontext, um den enormen Wohnraummangel zu bekämpfen. Ab dem Jahr 1946 wies der Zensus in den Westzonen 13,7 Millionen Haushalte und nur 8,2 Millionen Wohnungen aus. Politische Maßnahmen wie das erste Wohnungsbaugesetz von 1950 wurden entwickelnd, um den Bau von Millionen neuer Wohnungen zu fördern, sowohl durch staatliche als auch private Mittel, wie die Schader-Stiftung erläutert.
In den folgenden Jahrzehnten war die Wohnungspolitik ein zentraler Bestandteil der Sozialpolitik in Deutschland. Es entstanden verschiedene Instrumente und Reformen, aimed at facilitating affordable housing and managing the housing market more effectively. Speziell in den 1990er Jahren, nach der Wiedervereinigung, wurde die Wohnungspolitik im Osten neu aktiviert, um den Bedarf an Wohnraum zu stabilisieren. Doch auch heute gibt es noch große Herausforderungen, insbesondere in Ballungsräumen, wo der Druck auf den Wohnungsmarkt steigt, wie die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen.
Die Geschichte von Gettorf und der Siedlung im Parkwinkel ist somit auch ein Spiegelbild der Herausforderungen und Fortschritte der deutschen Wohnungspolitik. Das Jubiläum lädt nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Nachdenken über die Entwicklung des Wohnens in Deutschland ein – ein Thema, das viele Menschen betrifft und immer wieder in den Fokus der politischen Debatte rückt.
