Regierungspräsidium gibt grünes Licht für strittige Klärschlamm-Anlage in Walheim!
Das Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim trotz erheblichem Widerstand.
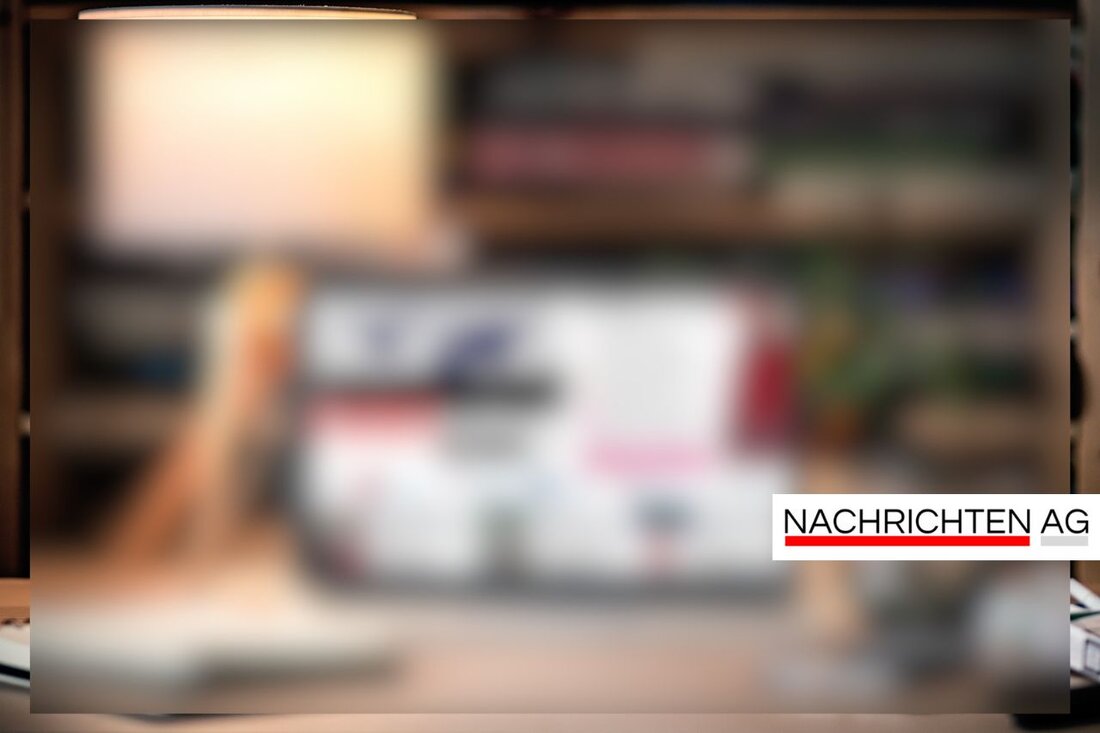
Regierungspräsidium gibt grünes Licht für strittige Klärschlamm-Anlage in Walheim!
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat entschieden: Der Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim wird realisiert. Trotz des heftigen Widerstands aus der Bevölkerung, der sich in 731 Einwendungen bis zum Frühjahr 2024 niedergeschlagen hat, wurde die Genehmigung für die Anlage erteilt. Die Genehmigung umfasst die Installation der Anlage; die Betriebsgenehmigung ist jedoch noch ausstehend, sodass die Bürger noch nicht entspannt aufatmen können. Auch die vollständige Einhaltung der Betreiberpflichten steht noch im Raum, zumal ein gesondertes wasserrechtliches Verfahren für die geplante Grundwasserentnahme erforderlich ist. Bürgerinitiative Bürger im Neckartal reagierte mit Verärgerung auf die Entscheidung, hatte jedoch mit einer solchen Genehmigung gerechnet. Walheims Bürgermeister Christoph Herre äußert deutliche Bedenken und sieht die Lebensqualität der Anwohner im Neckartal gefährdet. Die angrenzenden Gemeinden Walheim, Kirchheim, Gemmrigheim und Besigheim haben ebenfalls ihr Missfallen über den vorzeitigen Baubeginn zum Ausdruck gebracht und klagen gegen die Genehmigung. Sie fordern strenge Vorgaben zum Emissions- und Lärmschutz sowie zur Luftreinhaltung. Stuttgarter Nachrichten berichtet.
Im Rahmen der Vorbereitungen für dieses umstrittene Projekt fanden bereits mehrere Gespräche statt. Im Dezember 2024 wurden die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sowie Vertreter der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) und des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) zu einem Informationsaustausch eingeladen. Bei diesem Treffen wurde beschlossen, weitere Gespräche zu führen, um die Bedenken der Anlieger zu diskutieren. Am 29. Januar 2025 fand eine erneute Zusammenkunft in Besigheim statt, bei der technische Themen wie eine mögliche Abwasserdruckleitung erörtert wurden. Die EnBW prüfte die Anregungen und bot an, den Rückbau des bestehenden Schornsteins zu übernehmen. Es wurde auch diskutiert, wie der Abtransport des Brüdenabwassers optimiert werden kann, mit der Möglichkeit, hierfür die Bahn zu nutzen. Ob diese Vorschläge dazu beitragen können, die Akzeptanz des Projektes zu erhöhen, bleibt abzuwarten, da auch hier das Spannungsfeld zwischen notwendiger Technologie und Umweltbelangen deutlich zu spüren ist. RP Baden-Württemberg berichtet.
Nachhaltigkeit und Emissionen im Fokus
Die Diskussion über die Klärschlammverbrennungsanlage wird auch vor dem Hintergrund der kürzlich aktualisierten Klärschlammverordnung (AbfKlärV) von 2017 geführt. Diese setzt klare Fristen für das Recycling von Phosphor aus Klärschlamm, wobei ab 2032 die bodenbezogene Verwertung für große Kläranlagen verboten ist. Kritiker, wie der Bund Naturschutz, warnen vor den hohen CO2-Emissionen, die durch Monoverbrennungsanlagen entstehen. Laut einer Studie des Beratungsbüros Björnsen im Auftrag des BN, haben solche Anlagen die schlechteste CO2-Bilanz, was die Nachhaltigkeit in Frage stellt. Dr. Christine Margraf weist darauf hin, dass Klärschlammverbrennung allein kein Verfahren zum Recycling von Phosphor darstellt.
In einer umfassenden Analyse wird die Klärschlamm-Monoverbrennung mit Phosphor-Recycling (AshDec) betrachtet, die 99 kg CO2-Äquivalente pro kg Phosphor verursacht, während alternative Verfahren wie die Pyrolyse, die als umweltfreundlicher gilt, deutlich niedrigere Treibhausgasemissionen aufweisen. Der Bedarf an Forschung zur effizienteren Gewinnung von Phosphor aus Klärschlamm-Asche wird unmissverständlich betont. Bund Naturschutz hebt hervor, dass zur nachhaltigen Lösung der Probleme auch politische Anstrengungen in Form von staatlicher Unterstützung für innovative Verfahren notwendig sind.
Die nächsten Schritte in den Verfahren und der Baufortschritt werden unter intensiver Beobachtung stehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Interessen der Bevölkerung angemessen Berücksichtigung finden und dass innovative Lösungen vorangetrieben werden, um den Ressourcenschutz im Einklang mit technischen Entwicklungen zu gewährleisten.


 Suche
Suche