Revolution in der Augenforschung: Tübingen und Paris vereint für Limits2Vision!
Tübingen und Paris starten Kooperation in der Augenforschung zur Untersuchung des Energiestoffwechsels der Netzhaut.
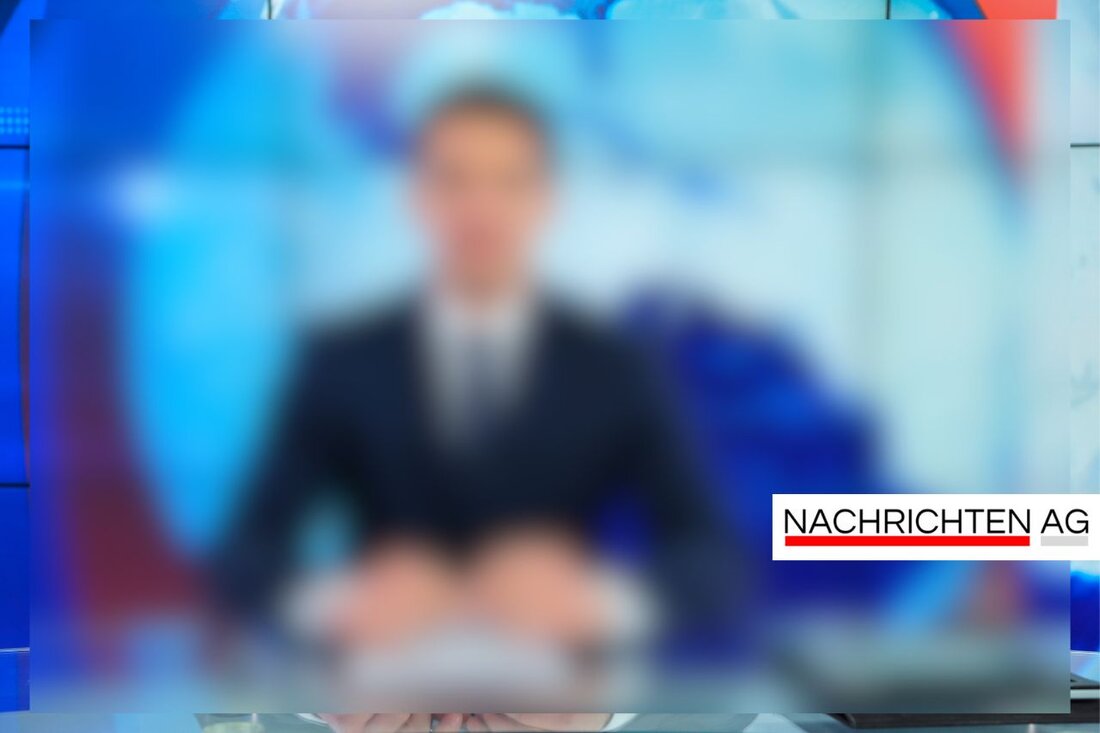
Revolution in der Augenforschung: Tübingen und Paris vereint für Limits2Vision!
In der Welt der Augenforschung tut sich einiges Spannendes. Ein neues, zukunftsweisendes Projekt vereint die Expertise von Deutschlands Universität Tübingen und dem Institut de la Vision (IDV) an der Sorbonne Université in Paris. Unter dem Titel „Limits2Vision“ nehmen Forscher aus beiden Ländern gemeinsam die Herausforderungen bei der Untersuchung des Energiestoffwechsels der Netzhaut ins Visier. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) unterstützen diese Initiative kräftig, denn ab Januar 2026 werden über fünf Millionen Euro in das Graduiertenkolleg fließen, um das Programm für fünf Jahre in die Tat umzusetzen, wie idw-online berichtet.
Die Netzhaut, ein komplexes Nervengewebe mit über 100 Zelltypen und einem enormen Energiebedarf, ist von zentraler Bedeutung für unsere Sehfähigkeit. Umso wichtiger ist es, die Mechanismen zu verstehen, die das Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und visueller Verarbeitung aufrechterhalten. An dem Projekt sind 17 Wissenschaftler aus Tübingen beteiligt, darunter 12 vom Forschungsinstitut für Augenheilkunde (FIA). Aus Paris bringen weitere 11 Forschende am IDV ihre Ideen und Erfahrungen ein.
Ein interdisziplinärer Ansatz
Was macht das Programm so besonders? „Limits2Vision“ setzt auf einen interdisziplinären Ansatz, der verschiedene wissenschaftliche Bereiche wie Neurobiologie, Physiologie, Pathologie und Künstliche Intelligenz miteinander verbindet. Dr. Alexandra Rebsam, eine der Hauptverantwortlichen des Projekts, hebt die symbolische Bedeutung der Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich hervor. Sie betont, dass durch diesen Austausch nicht nur wichtige Erkenntnisse gewonnen, sondern auch die Zukunft der translationalen Augenforschung entscheidend mitgestaltet werden soll.
Doch die Augenforschung steht nicht allein auf sich. Weltweit sind etwa zwei Millionen Menschen von Netzhauterkrankungen betroffen, die zu Erblindung führen können, wie ethz.ch berichtet. Erkrankungen wie Retinitis pigmentosa und altersbedingte Makuladegeneration machen hierbei besonders betroffen. Die einzige bisherige Lösung bieten elektronische Implantate, die eine Rückkehr zum Sehen ermöglichen, jedoch ist deren Funktionalität bislang beschränkt. Daher zielt ein aktuelles Projekt darauf ab, bestehende Netzhautimplantate weiterzuentwickeln.
Zusammenarbeit auf höchstem Niveau
Der Initiator dieses Projekts, der ursprünglich für eine andere Projektstelle bei Prof. Leuthold war, fand während des Wartens auf einen Termin zu einem anderen Thema das Projektblatt „Interdisziplinäres Projekt“. Mithilfe der Hector Fellow Academy, die interdisziplinäre Projekte fördert, wird nun Know-how über Netzhautimplantate und Photonik zusammengeführt. Die namhaften Professoren Zrenner und Leuthold spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Auf diese Weise wird nicht nur Forschung betrieben, sondern auch das Wissen der nächsten Generationen an Doktoranden vermittelt.
Künftig sollen im Rahmen des e-Retina-Projekts die einzelnen Bauteile von Netzhautimplantaten entwickelt und die Signalverarbeitung im beschriebenen Kontext vertieft betrachtet werden. Das Ziel? Die Verbindung der Bauteile, um die Signalverarbeitung von der Bildgebung bis zur Stimulation auf der Retina zu demonstrieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Sowohl „Limits2Vision“ als auch die Entwicklungen rund um Netzhautimplantate zeigen, dass der interdisziplinäre Austausch zwischen Wissenschaftlern auf internationaler Ebene nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist. Die tollen Fortschritte, die hier gemacht werden, könnten für viele Menschen den Unterschied zwischen Sehfähigkeit und Erblindung bedeuten. Hier liegt ein großes Potenzial, das es zu unterstützen und weiterzuverfolgen gilt.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto