Zwangseinweisungen für Gewalttäter: Mediziner schlagen Alarm!
Aschaffenburg im Fokus: Gewalttaten durch psychisch Kranke erfordern dringend neue Präventionsmaßnahmen und Debatten über Zwangseinweisungen.
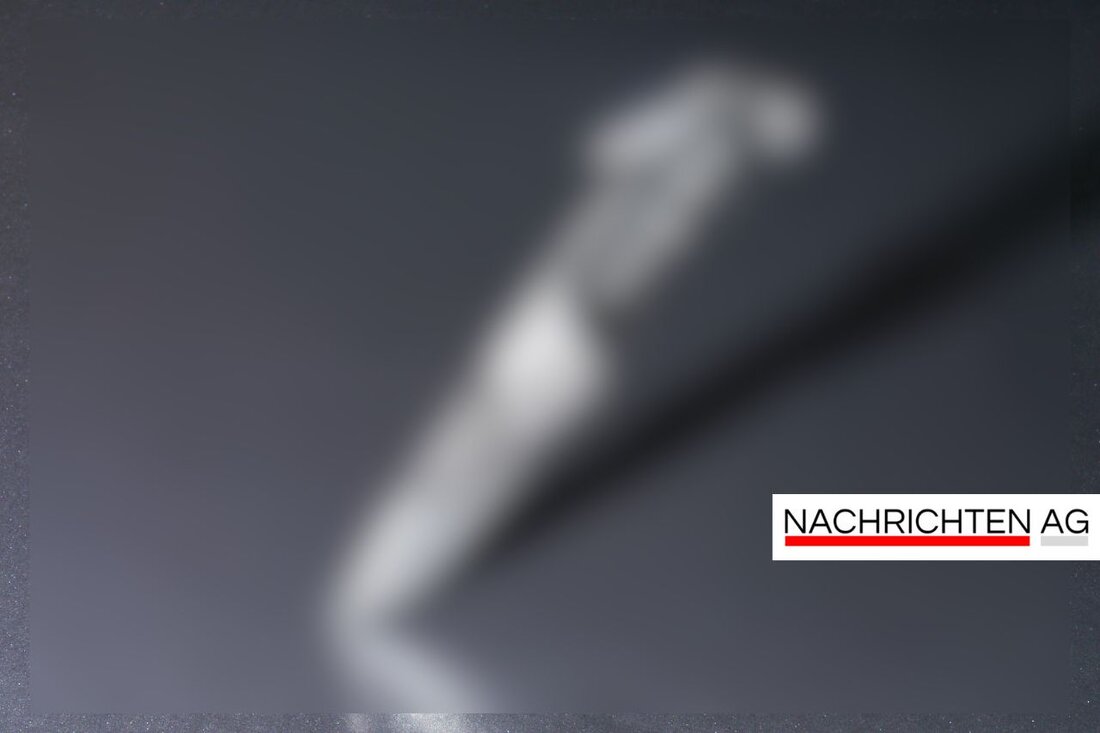
Zwangseinweisungen für Gewalttäter: Mediziner schlagen Alarm!
In Deutschland sind Gewalttaten, die von psychisch kranken Menschen begangen werden, ein alarmierendes Phänomen. So kam es jüngst zu schockierenden Vorfällen: Ein Mann tötete in Aschaffenburg zwei Personen mit einem Messer, und eine Frau verletzte am Hamburger Hauptbahnhof in einem Amoklauf 18 Menschen. Auch in München wurde ein Mann mit einem Messer auf zwei andere losgelassen. Diese Ereignisse werfen einmal mehr die Frage nach der Sicherheit der Gesellschaft und den Möglichkeiten des psychischen Gesundheitssystems auf. Laut Welt ist die Diskussion um Zwangseinweisungen von gewalttätigen Personen neu entbrannt.
Im Fokus steht ein neues Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). In diesem wird gefordert, die rechtlichen Möglichkeiten zu flexibilisieren, um gewalttätige Personen gegen ihren Willen in psychiatrische Behandlung zu nehmen. DGPPN-Präsidentin Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank hebt hervor, dass es nötig sei, die Balance zwischen individueller Freiheit und dem Schutz der Gemeinschaft zu finden. Ein akutes Gefährdungspotenzial werde oft nicht ausreichend nachgewiesen, was zu einer unnötig schnellen Entlassung aus der psychiatrischen Klinik führe. Tragisch ist der Fall der Frau, die in Hamburg stach und erst einen Tag zuvor aus einer Behandlung entlassen wurde.
Die Rolle der Behandlung und Prävention
Die DGPPN und die Deutsche Gesellschaft für Seelische Gesundheit (DGSP), die das Positionspapier unterstützen, betonen, dass die frühzeitige und konsequente Behandlung psychischer Erkrankungen die wirksamste Strategie zur Gewaltprävention darstellt. Dabei sind insbesondere Psychosen und Substanzabhängigkeiten Störungen mit einem statistisch erhöhten Risiko für Gewalthandlungen. Es ist wichtig zu betonen, dass psychisch kranke Menschen häufig eher Opfer von Gewalt sind als Täter.
Um den Bedarf für eine bessere Versorgung zu decken, wird ein Ausbau gemeindepsychiatrischer und forensischer Versorgungsstrukturen gefordert. Dazu zählen niedrigschwellige Hilfen und aufsuchende Dienste, die die Betroffenen direkt erreichen können. Anstatt in ein Register aufgenommen zu werden, sollten stattdessen therapeutische Auflagen bei Entlassungen besser genutzt werden. Politische Diskussionen, die sich mit Registrierungen und Datensammlungen beschäftigen, könnten die Betroffenen weiter stigmatisieren und ihrer Versorgung schaden, warnt die DGPPN.
Stigmatisierung überwinden
Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist eine weitere Hürde, die es zu überwinden gilt. Viele Betroffene fühlen sich ausgegrenzt und haben Angst, Hilfe zu suchen, was das Risiko erhöht, dass ihre Erkrankung chronisch wird. Laut einem Bericht im Ärzteblatt ist das Stigma nicht nur eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen, sondern wird auch als „zweite Krankheit“ bezeichnet.
Um dieser Problematik entgegenzuwirken, gibt es bundesweite Aktivitäten, wie die Aktionswoche Seelische Gesundheit, die jährlich im Oktober stattfindet. Im Koalitionsvertrag von 2021 wird eine Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen angekündigt. Auch evidenzbasierte Strategien zur Reduzierung der Stigmatisierung werden gefordert. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für psychische Erkrankungen zu fördern und Vorurteile abzubauen.
Insgesamt sind sich die Experten einig, dass ein Umdenken in der Gesellschaft nötig ist, um den Herausforderungen im Bereich psychische Gesundheit begegnen zu können. Die Diskussion über Zwangseinweisungen zeigt, dass die Problematik komplex ist und zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden müssen, um sowohl den Bedürfnissen der Betroffenen als auch der Sicherheit der Allgemeinheit gerecht zu werden.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto