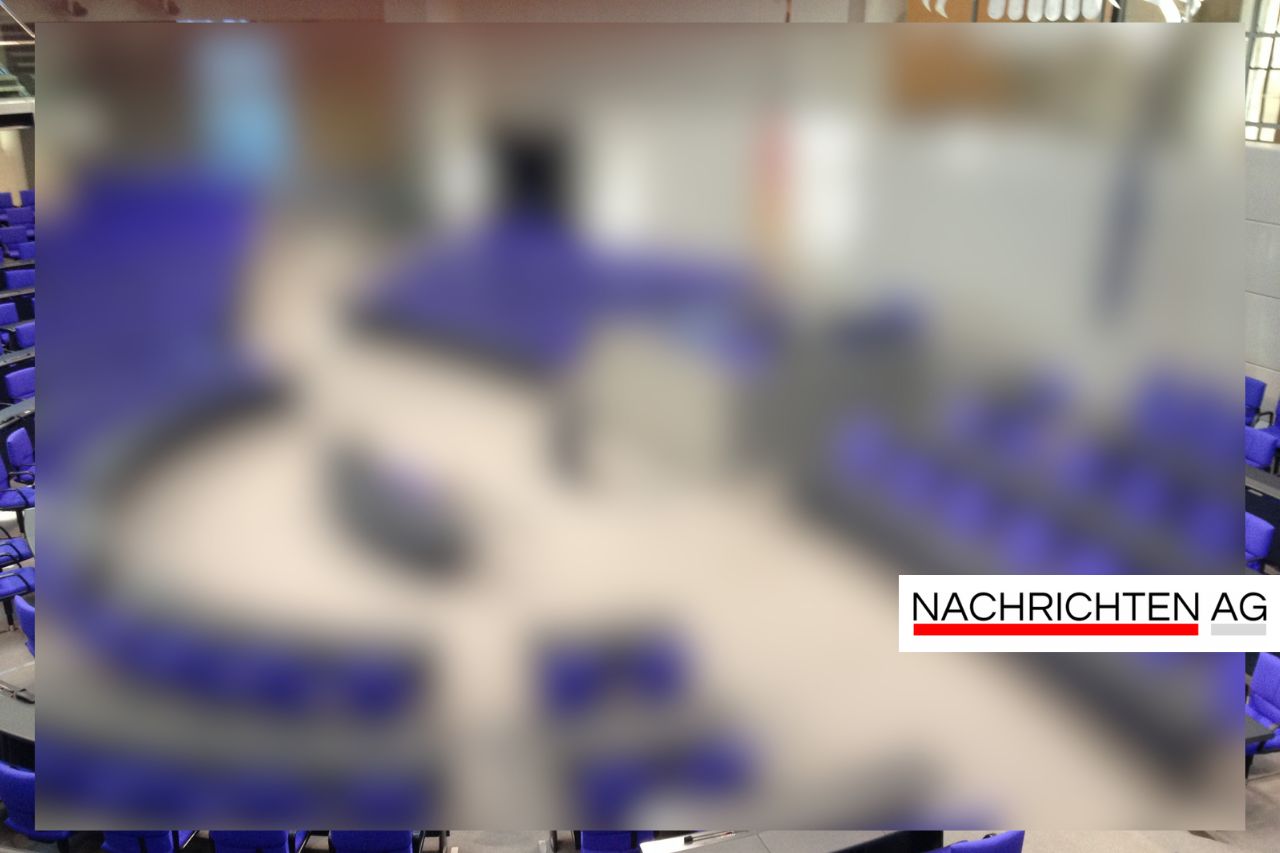
Das Thema Hochwasserschutz rückt aktuell in den Fokus der Öffentlichkeit, denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in ihrer neuesten Bewertung die unzureichende Hochwasservorbereitung in verschiedenen Bundesländern kritisiert. Vor allem Bayern sticht ins Auge, als Bundesland mit dem höchsten Risikograd für ein Jahrhunderthochwasser. Hier wären rund 65.517 Wohnadressen in betroffenen Gebieten – eine alarmierende Zahl, die viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Auch in anderen Regionen wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg bestehen erhebliche Risiken, die nicht ignoriert werden können. Der Bericht von Brennessel verdeutlicht den drängenden Nachholbedarf im Bereich des naturbasierten Hochwasserschutzes.
Die DUH fordert daher einen klaren Kurswechsel hin zu mehr naturbasierten Maßnahmen, wie etwa der Renaturierung von Auen und Flüssen. Dies ist besonders wichtig, da Blitzüberschwemmungen und Starkregenereignisse durch den Klimawandel in Zukunft zunehmen werden. Die Klimakrise hat bereits 2021 durch katastrophale Hochwasserereignisse eindrücklich gezeigt, dass die bestehenden Schutzmaßnahmen allein nicht ausreichen. Die Bundesregierung hat deshalb ein umfassendes Hochwasser-Risikomanagement ins Leben gerufen, um die Folgen solcher Wetterereignisse zu reduzieren.
Nachholbedarf in allen Bundesländern
Eine Analyse der Hochwasservorsorge, die von der DUH zwischen 2014 und 2024 durchgeführt wurde, zeigte, dass kein Bundesland tatsächlich alle erforderlichen Maßnahmen überzeugend umgesetzt hat. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls zu den Bundesländern mit extremem Risikograd gehört, besteht dringender Handlungsbedarf. Dort sind 6,8% der Flächen als Risikogebiete identifiziert, was den Druck auf die Politik erhöht, zahlreiche Stellschrauben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zu aktivieren.
- Unterstützung der Kommunen für Anpassungen an Extremwetter.
- Vorrang für naturbasierten Hochwasserschutz.
- Förderung von Rückbaumaßnahmen in Überschwemmungsgebieten.
- Erhebung und Vergleichbarkeit von Daten zu Hochwasserschutzmaßnahmen.
- Austausch zwischen Bundesländern zu Lösungen im naturbasierten Hochwasserschutz.
Zusätzlich zeigt der Bericht auf, dass technische Hochwasserschutzmaßnahmen allein keine absolute Sicherheit bieten können. Die Bundesregierung plant daher, die rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Unterstützungssysteme zu verbessern, um den Kommunen zu helfen, sich besser auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.
Klimaanpassungsstrategie der Bundesregierung
Das Sofortprogramm zur Klimaanpassung sieht eine Förderung von 60 Millionen Euro für Kommunen vor, um die Klimavorsorge insgesamt zu verbessern. Die neue Klimaanpassungsstrategie fokussiert sich dabei auf die Themen Starkregenmanagement und Renaturierung. Hier würde eine tiefere Vernetzung von kommunalen Akteuren und die Schaffung einheitlicher Standards zur Bewertung von Hochwasser- und Starkregenrisiken, wie sie auch im Programm zur Naturkonditionierung verankert sind, entscheidend sein. Die Presseportal beschreibt auch, wie bestimmte Maßnahmen zur Erweiterung von Überflutungsflächen und die Verbesserung der Rückhaltebecken eingeleitet werden.
Abschließend lässt sich festhalten, dass auf allen Ebenen, von den Kommunen bis hin zur Bundesregierung, Handlungsbedarf besteht. Die zunehmenden Extremwetterereignisse durch den Klimawandel halten uns den Spiegel vor: Es ist höchste Zeit, dass wir in einem zukunftsfähigen Hochwasserschutz nicht nur präventiv denken, sondern auch aktiv werden.
