Die vergessenen Löhne: Schicksale der afrikanischen Vertragsarbeiter in der DDR
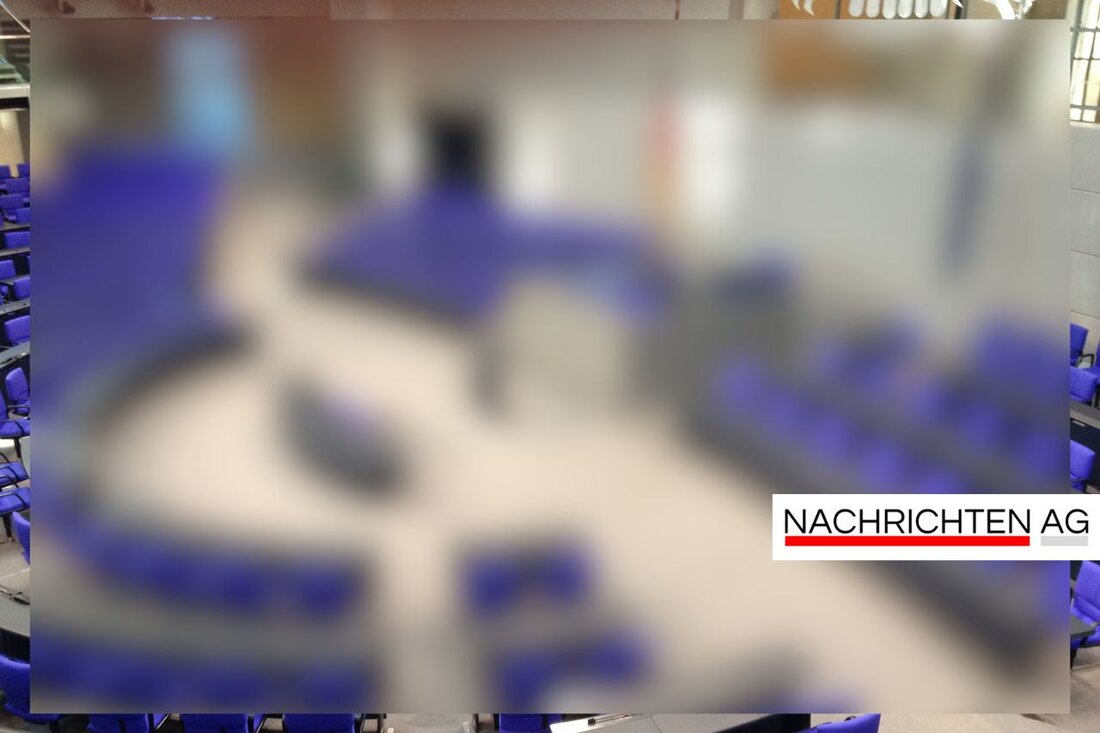
Potsdam, Deutschland - In den 1980er Jahren lebten viele Menschen aus sozialistischen Staaten, insbesondere aus Mosambik und Angola, als „Vertragsarbeiter“ in der DDR. Rund 24.000 Personen wurden von den Versprechungen auf gute Ausbildung und Bezahlung angezogen. Prof. Dr. Marcia C. Schenck, eine Historikerin aus Potsdam, erforscht die Geschichte dieser Arbeiter aus ihrer Perspektive. In ihrer Arbeit beleuchtet sie, dass vieler dieser Menschen bis heute auf Teile ihres Lohns warten, der als Tauschmasse im Handel zwischen den Staaten diente. Das Schicksal dieser „Madgermanes“, wie die mosambikanischen Vertragsarbeiter genannt wurden, ist Teil einer komplexen Geschichte, die im Kontext des Kalten Krieges verstanden werden muss.
Nach der Unabhängigkeit Angolas und Mosambiks im Jahr 1975 nahmen diese Länder die Entsendung von Arbeitskräften in die DDR auf, um Unterstützung beim Aufbau ihrer Wirtschaft zu erhalten. Während Angola 1984 und Mosambik 1979 Arbeitskräfte entsandte, blieb der erhoffte Fortschritt häufig aus, bedingt durch Bürgerkriege und wirtschaftliche Probleme in den entsendenden Ländern. Die DDR wiederum stellte zahlreiche Ausbildungsplätze zur Verfügung, verschloss jedoch oft die Augen vor den Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen dieser Arbeiter.
Verborgene Löhne und ein Aufruf zur Anerkennung
Ein erheblicher Teil der Löhne der Vertragsarbeiter wurde einbehalten, um die Schulden der afrikanischen Staaten bei der DDR abzubauen. Diese Praxis führte zu einer gegenseitigen Abhängigkeit, da Mosambik und Angola weiterhin Arbeitskräfte entsandten, während die Arbeiter unter finanziellen und sozialen Schwierigkeiten litten. Mehrere ehemalige Vertragsarbeiter haben inzwischen Protestbewegungen gegründet, um ausstehende Löhne einzufordern und als Opfer sozialistischer Politik anerkannt zu werden. Historikerin Christine Bartlitz entdeckte kürzlich auf einer Tagung eine Sammlung von Fotos, die die stolzen Gesichter mosambikanischer Vertragsarbeiter dokumentieren.
In einem offenen Brief appellierten Bartlitz und Isabel Enzenbach an die Bundesregierung, mehr Verantwortung für die „Madgermanes“ zu übernehmen. Über 100 Historiker forderten, dass das Schicksal dieser Gruppe, das im Einigungsvertrag nicht behandelt wurde, endlich gewürdigt wird. Seit mehr als 30 Jahren protestieren die „Madgermanes“ gegen die Ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren sind. Die Bundesregierung hingegen betrachtet das Thema als abgegolten, was die Betroffenen und viele Wissenschaftler als unzureichend empfinden.
Persönliche Geschichten und globale Zusammenhänge
Die Berichte von ehemaligen Vertragsarbeitern erzählen von einem Leben voller Widersprüche: positive Erfahrungen in der Ausbildung stehen negativen Erlebnissen wie Rassismus gegenüber. Viele davon erinnern sich nostalgisch an ihre Zeit in der DDR, kritisieren jedoch gleichzeitig die aktuellen Gegebenheiten in ihren Herkunftsländern. Prof. Schenck hat seit 2011 über 260 Interviews mit ehemaligen Vertragsarbeitern, Studierenden und Regierungsvertretern in Mosambik und Angola durchgeführt. Diese Interviews haben Grundlage für ihre Forschungsarbeit und eine kollektive Biografie geboten, die individuelle Erinnerungen mit der großen Weltgeschichte verbinden soll.
Der mikrogeschichtliche Ansatz von Schencks Forschung unterstreicht die globale Verwobenheit der Ereignisse und bietet eine tiefere Perspektive auf die Geschichte der Vertragsarbeit. In einer Zeit, in der alte Narrativen der DDR-Geschichte hinterfragt werden, trägt ihre Arbeit dazu bei, gängige Fehlannahmen zu korrigieren und die Stimmen der Vertragsarbeiter Gehör zu verschaffen. Es ist ein bedeutendes Unterfangen, das endlich die Geschichte dieser weitgehend marginalisierten Gruppe ins Licht rückt.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass rund 17.000 mosambikanische Vertragsarbeiter in der DDR von Ausgrenzung und Rassismus betroffen waren und dass viele von ihnen mit einer erheblichen finanziellen Benachteiligung nach ihrer Rückkehr konfrontiert waren. Die Forderungen nach Anerkennung und Entschädigung für das erlittene Unrecht sind heute aktueller denn je.
Die Entwicklung um die „Madgermanes“ zeigt eindrücklich, wie komplex die Verflechtungen von Arbeitsmigration, sozialistischer Politik und deren Auswirkungen auf individuelle Biografien sind. Die Diskussion über Löhne, soziale Verantwortung und rechtliche Anerkennung wird weiterhin geführt.
Die Ergebnisse von Professor Schenck und ihren KollegInnen sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer umfassenderen und nuancierteren Darstellung dieser Lebensgeschichte.
Uni Potsdam berichtet, dass …
Deutschlandfunk erläutert …
DOMID skizziert …
| Details | |
|---|---|
| Ort | Potsdam, Deutschland |
| Quellen | |
