Familienleben in Ostdeutschland: Traditionen zwischen Generationen leben
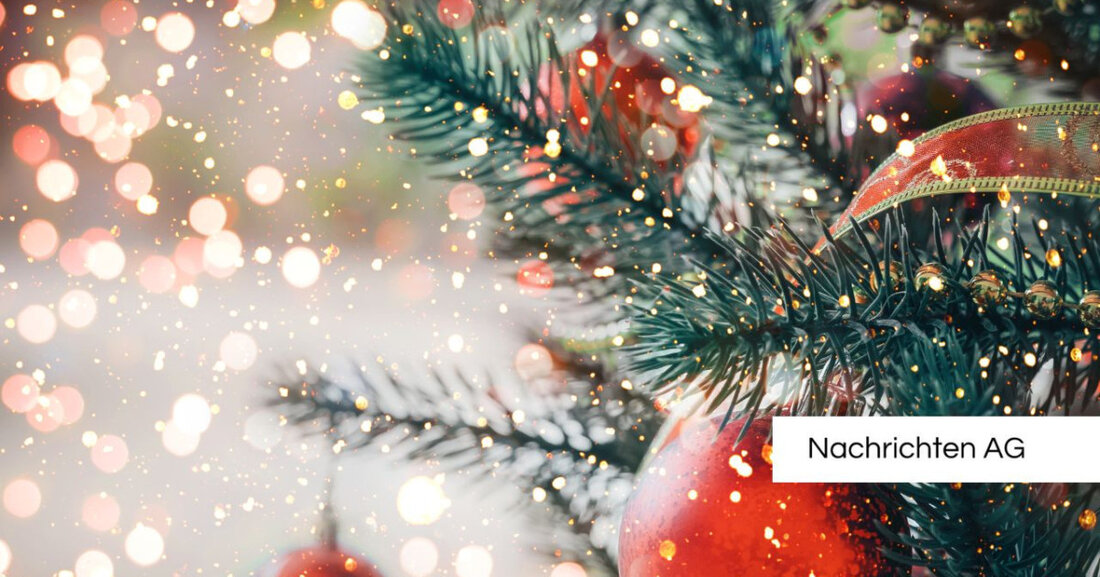
Berlin, Deutschland - In Ostdeutschland weist der Anteil der Menschen, die einer Konfession angehören, nur etwa 16 Prozent aus. Dies hat Dr. Hagen Findeis von der Martin-Luther-Universität Halle in seinem Forschungsprojekt „Religiosität in ostdeutschen Familien“ festgestellt. Im Rahmen der dreijährigen Studie begleitet Findeis Familien über mehrere Generationen und untersucht die Gestaltung ihres Familienlebens, besonders in der Auseinandersetzung mit religiösen und sozialen Praktiken. So kommt es an den klassischen Familientreffen wie Geburtstagen, Hochzeiten oder Feiertagen immer wieder zu spannenden Interaktionen zwischen den Generationen.
Ein zentrales Element der Studie sind Leitfaden-Interviews, bei denen Familien über prägende Erlebnisse und Konflikte in ihrem Zusammenleben berichten. Die Einstiegsfrage lautet: „Was haben Sie letztes Weihnachten gemacht?“ Diese Interviews sollen ein tieferes Verständnis dafür vermitteln, wie Religiosität im Alltag praktisch erlebt wird. Überraschend ergab die Studie, dass nicht ausschließlich Großeltern die Bewahrer religiöser Traditionen sind, sondern auch Kinder und Eltern aktive Rollen einnehmen. Dies spiegelt das zunehmend partnerschaftliche Erziehungsbild wider, in dem Kinder als gleichwertige Partner wahrgenommen werden.
Familienreligiosität und ihre Dimensionen
Familienreligiosität wird dabei als soziale Praxis betrachtet, die sich kontinuierlich neu gestaltet. Laut einem Artikel auf Theo-Web werden wesentliche Begriffe wie Familie, Religiosität und Familienreligiosität umfassend definiert. Familie wird nicht nur durch Verwandtschaftsverhältnisse gebildet, sondern auch durch emotionale und soziale Bindungen über mindestens zwei Generationen hinweg. Die Studie teilt Familienreligiosität in zwei Kategorien auf: die implizite Dimension, die durch die grundlegende Erfahrung von Akzeptanz geprägt ist, und die explizite Dimension, die die Kommunikation über religiöse Praktiken umfasst.
Das heuristische Rahmenmodell für Familienreligiosität greift auf systemische und bindungstheoretische Erkenntnisse zurück. Hierbei wird die Bedeutung von Geborgenheit in Familienbeziehungen hervorgehoben. Die Autoren plädieren dafür, empirische Forschungen zu intensivieren, um die komplexe Ausgestaltung von Familienreligiosität besser zu verstehen. Wichtig ist auch die Rolle von Ritualen im Alltag, sei es in Form von Gebeten oder gemeinsamer Musik. Diese tragen stark zur Weitergabe und Verankerung von Werten innerhalb der Familie bei.
Aktuelle Herausforderungen und Erwartungen
Dr. Findeis weist zudem darauf hin, dass es in Krisenzeiten nicht zu einer gesamtgesellschaftlichen Rückbesinnung auf Religiosität kommt. Obgleich konfessionslose Menschen hohe Erwartungen an die Kirchen haben, insbesondere in sozialen und umweltpolitischen Fragen, wünschen sie sich, dass religiöse Menschen den Kontakt zu Gott weiterhin pflegen. Dies zeigt, dass trotz der geringen Zahl konfessionell gebundener Menschen in Ostdeutschland ein starkes Bedürfnis nach spirituellem Austausch besteht.
Zusammenfassend beleuchtet die Forschung zur Religiosität in Ostdeutschland die verschiedenen Facetten und Herausforderungen der religiösen Identität innerhalb von Familien. Sie bringt die Dynamik zwischen Tradition und Moderne in unserer Gesellschaft zur Sprache und zeigt, wie wichtig es ist, den intergenerationellen Dialog zu fördern.
Für weitere Informationen über die Hintergründe dieser Forschung und ihre Ergebnisse finden Sie die detaillierte Studie auf MDR sowie zusätzliche Ansichten zu Familienreligiosität in der aktuellen Publikation auf Theo-Web.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Berlin, Deutschland |
| Quellen | |
